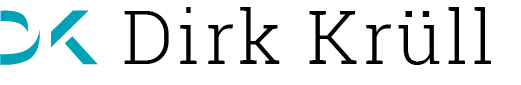Die Vergegenwärtigung des Arbeitsalltags unserer Vorfahren hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Da im Westdeutschland der 50er- und 60er-Jahre veraltete Produktionsstätten nicht nur stillgelegt, sondern auch weitgehend vernichtet wurden, müssen die Bedingungen, unter denen früher produziert wurde, heute oft mühsam rekonstruiert werden.
Anders in der ehemaligen DDR nach der Wende: Aufgrund fehlender Investitionsmittel konservierten sich dort Produktionsmethoden und Betriebseinrichtungen, die wir heute als technische Kulturdenkmale betrachten. Die Planwirtschaft brachte es mit sich, dass veraltete und unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten völlig unrentable Betriebe am Leben erhalten wurden, was uns Westdeutsche seit der Wende authentische Einblicke in historische Produktionsverhältnisse erlaubt. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet in einem Staat, dem es um die Revolutionierung der Produktionsverhältnisse ging, hatten sich frühkapitalistische Produktionsweisen erhalten
Und das war für mich das Verlockende: Historische Arbeitsbedingungen, die sonst in musealen Vorführbetrieben rekonstruiert werden müssten, waren hier gewissermaßen live erfahrbar. Über die Dokumentation der historischen Technik hinaus ergab sich so die Möglichkeit, ein Bild des Alltags unter diesen Arbeitsbedingungen zu zeichnen. Dabei trat etwas Erstaunliches zutage: Im Gegensatz zur verbreiteten Entfremdungsphilosophie des Individuums in der Industriearbeit spürte ich in vielen dieser Betriebe eine besondere Affinität der Arbeiter zu „ihren“ Maschinen und „ihrem“ Betrieb – notgedrungen vermutlich, da an moderne Produktionsmittel nicht zu denken und an Ersatzteile schwer heranzukommen war.
Jedem musste klar sein, dass diese historischen Produktionsmethoden nach der Wende nicht überlebensfähig waren. Ein Aspekt meiner Dokumentation war daher der beklemmende Stillstand bereits zu DDR-Zeiten, der den Niedergang dieser Industriekultur schon ankündigte.